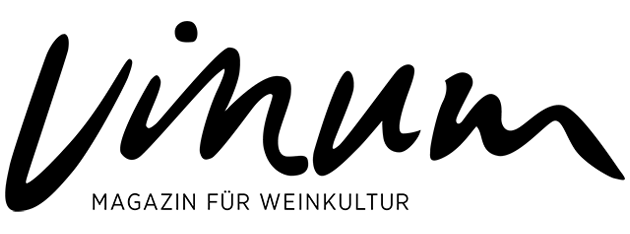Ahr - Neubeginn nach der Flut
Auf Kalk kann es jeder
Text: Harald Scholl, Foto: GettyImages / AL-Travelpicture, Harald Scholl, ikonodule.de, Dominik Ketz, schmidtchen & partner Werbeagentur GmbH, z.V.g.

Wer Pinot sagt, denkt an Kalk. Doch die Ahr zeigt, dass Eleganz auch dort entsteht, wo der Boden härter antwortet. Schiefer und Grauwacke formen Spätburgunder, die heute leichter und fokussierter sind als je zuvor – und dabei sind sie von leichtfüssiger Eleganz. Eine Region, die sich neu erfunden hat, beweist, dass Herkunft keine Frage des Prestigebodens ist. Auf Kalk gelingt vieles. Auf Schiefer gelingt Charakter.
Man sollte sich die Mühe machen und mit dem Auto von Bad Neuenahr hinauf ins Tal fahren, hinein nach Rech, Dernau, Mayschoß. Diese paar Kilometer genügen, um die Ahr zu verstehen – oder wenigstens zu ahnen, was sie ausmacht. Die Spuren der Flut vom Juli 2021 sind noch immer unübersehbar: Erdgeschosswohnungen, die seit drei Jahren niemand mehr bewohnt, notdürftig mit Pressholzplatten vernagelt; frisch gezogene Leitungen, Baugerüste, aufgerissene Strassen. Wiederaufbau als Dauerzustand. Und doch wirkt es fast unwirklich, dass hier vor so kurzer Zeit ein Tal aus den Fugen geraten ist. Jeder Hang, jeder Bachzulauf, jede Steinmauer scheint die Geschichte noch zu erzählen.

Gleichzeitig liegt diese Faszination in der Luft, die man kaum erklären kann, solange man die Ahr nur aus dem Weinregal kennt. Auf wenigen Kilometern drängen sich Terrassen, steile Wände, Mauern, Mini-Parzellen, die ohne Übertreibung zu den schwierigsten Weinlagen Deutschlands zählen. Einzelstock-Erziehung, Stöcke, die in kleinen, handtuchgrossen Parzellen stehen; vier Reben nebeneinander, dann eine Mauer aus Naturstein, darüber in zwei Metern Höhe die nächsten 20 Stöcke. Eine vertikale Welt, gebaut von Generationen, die offensichtlich ein anderes Verhältnis zu Arbeit hatten. Man sieht diese Terrassen und fragt sich, wie jemand hier überhaupt ernten kann, wie man den Hang hält, wie man Reben pflegt, die eher wie Bergpflanzen denn wie Nutzpflanzen wirken. Und spätestens dann versteht man, weshalb das Wort «Handarbeit» an der Ahr keinen Marketingwert hat, sondern schlichte Beschreibung ist. Es ist nicht nur ein Weinberg, der so aussieht, sondern ein ganzes System von Miniaturterrassen, Kanten, Vorsprüngen, schmalen Wegen, die immer der Ahr folgen. Diesem Fluss, der Leben und Wein bringt – und der doch in einer einzigen Nacht so viel zerstört hat. Selbst ein hartgesottener Reporter, der seit Jahrzehnten durch Weinberge stolpert, kann diese Mischung aus Schönheit und Verletzlichkeit nicht einfach von sich schieben. Das Tal arbeitet, baut, rekonstruiert – und still darunter liegt ein Ton, der einen nicht loslässt.
«Vielleicht hat die Flut auch so manches Verstaubte fortgespült. Die Chance für etwas Neues wurde überall genutzt.»
Vielleicht ist es genau diese Spannung, die den Weinen hier ihre eigene Energie gibt. Dörthe Näkel sagt: «Es braucht die Vielfalt, gerade junge, unkonventionelle Betriebe sorgen für das neue Bild der Ahr.» Und ihre Schwester Meike fügt hinzu: «Vielleicht hat die Flut auch so manches Verstaubte fortgespült. Die Chance für etwas Neues wurde überall genutzt.» Beides stimmt, und beides spürt man sofort – mit Blick auf die Terrassen, in Gesprächen über Biodiversität, in der Art, wie heute Wein gemacht wird: weniger auf Prestige bedacht, stärker auf Herkunft, präziser in der Arbeit. Die Ahr hat gerade erst begonnen, sich neu zu erfinden. Und vielleicht erklärt sich ausgerechnet hier, in diesem engen Tal aus Schiefer und Grauwacke, warum der Satz «Auf Kalk kann es ja jeder» mehr ist als ein Seitenhieb. Es ist eine Positionsbestimmung. Die Ahr muss nichts kopieren. Sie zeigt, wie weit man mit Konsequenz, Hartnäckigkeit und ein wenig Trotz kommen kann – auch oder gerade, wenn man von Schiefer erzählt.

Grösse aus der Not entstanden
Das Weingut Meyer-Näkel ist heute das sichtbarste Beispiel dafür, wie viel Kraft in der Ahr steckt, wenn man Herkunft nicht als Schlagwort, sondern als Arbeitsprinzip versteht. Und womöglich liegt die grösste Überraschung darin, wo diese Weine entstehen: in einer ungedämmten Blechhalle am Ortsrand, ein Provisorium, das längst zum Dauerzustand geworden ist. Ein Raum, der aussieht, als hätte er mit den feinsten Spätburgundern Deutschlands nur am Rande zu tun. Die geflickten Wände zeigen die Spuren der Verwüstung, im Winter kämpft man mit Heizlüftern gegen die Kälte an, und der Maschinenpark würde in manch anderem Topbetrieb als Rudiment gelten. Weniger Equipment ist kaum denkbar, doch schwingt genau darin eine Art stiller Trotz. Als hätte die Flut den Betrieb auf seine Essenz zurückgeworfen, als hätte man dabei festgestellt, dass diese Essenz genügt. Gerade darin liegt die Eigenart dieser Weine: Sie entstehen ohne Gedöns, ohne Mittelchen, ohne die Versuchung glänzender Technik. Was im Weinberg nicht stimmt, lässt sich hier nicht reparieren, und was stimmt, bleibt unangetastet. Es erzeugt eine unangestrengte Präzision, die man nicht planen kann.

Schon der erste Schluck eines aktuellen Spätburgunders aus dem Kräuterbergs wirkt, als sei er von innen heraus sortiert: die rote Frucht kühl und klar, die Gerbstoffe wie mit dem Seziermesser gezogen, die Spannung fast transparent. Dazu die Schieferwürze, die sich niemals in den Vordergrund drängt und doch alles rahmt. Im direkten Vergleich fällt auf, wie ungekünstelt diese Weine wirken, wie selbstverständlich sie ihre Herkunft tragen. Dass ausgerechnet in dieser improvisierten Halle der beste deutsche Spätburgunder der Jahre 2024 und 2025 entstanden ist, wirkt wie eine stille Pointe der Ahr. Nach dem Titel «Weingut des Jahres» im «VINUM Weinguide 2024» folgten zwei Siege in Serie beim Spätburgunder – ein Novum in der Geschichte des Guides. Und es zeigt, wie wenig Prestige-Architektur darüber entscheidet, wie gross ein Pinot werden kann.
«Immer wenn ich in den Weinberg gehe und in die Hände klatsche, wissen die Schafe: ‹Da kommt die Futtertante.›»
Die Näkels arbeiten heute konzentrierter als je zuvor. Sie justieren Kleinigkeiten, lesen früher, sortieren härter, denken stärker in Mikroparzellen. In der Dernauer Goldkaul, einer noch nicht klassifizierten, aber unstrittig grossen Lage, stehen bis zu 13 000 Stöcke pro Hektar an hölzernen Pfählen, die eher an Gebirgspflege erinnern als an Weinbau. Die Biodiversität organisiert sich hier fast von selbst: Mauereidechsen, Kräuter, Insekten, ein Gewirr aus Mikroklima und Stein. Und irgendwo in dieser Landschaft liegt auch der Grund dafür, dass diese Weine eine Leichtigkeit besitzen, die nichts mit Alkoholgrad, sondern mit innerer Balance zu tun hat. Dörthe Näkel sagt, die Ahr brauche Vielfalt, gerade junge und unkonventionelle Betriebe würden das neue Bild prägen. Ihr Satz beschreibt zugleich den eigenen Wandel. Vieles hat sich verändert seit der Flut, manches ist schärfer geworden, weniger eitel, zielgerichteter. Und vielleicht erklärt sich damit auch der Erfolg dieser Jahre. Die Ahr, so scheint es, macht keine Weine mehr für den Lärm. Sie macht Weine, die leise sprechen und lange bleiben. Und Meyer-Näkel steht im Zentrum dieses neuen Tons.

Teamwork mit Schafen
Vielleicht erklärt sich der neue Ton an der Ahr auch darin, dass hier vieles auf geraden Wegen nicht mehr funktioniert. Eine Region, die Terrassen und Steilhänge wie Fingerabdrücke trägt, sucht sich ihre Methoden instinktiv. Und manchmal laufen einem diese Methoden buchstäblich entgegen. Bei Meyer-Näkel begegnet man ihnen in Form von Schafen, die zwischen den Zeilen der Terrassen ihre Arbeit verrichten. Ein Bild, das sich im Tal immer häufiger findet – und das bei einem Betrieb zu einer Art Grundsatzentscheidung geworden ist: Bertram-Baltes. Das Ehepaar Julia Bertram und Benni Baltes ist so etwas wie die Avantgarde der Ahr, und es ist bemerkenswert, wie selbstverständlich sie diesen Anspruch verkörpern, ohne ihn jemals auszusprechen. Ihr Weinbau beginnt nicht im Keller, sondern im Boden – oder genauer: im System, das den Boden lebendig hält. Permakultur ist für sie kein Etikett, sondern Alltag. Die Schafe sind dabei die sichtbarsten Mitarbeiter, sie halten die Begrünung kurz, regulieren das Wachstum, schaffen Durchlüftung und bringen eine Ruhe in die Reben, die man den Weinen später anmerkt. Dazu kommt ein Erziehungssystem mit höher gezogen Stämmen, «Hochstammgobelet» nennt es Benni mit einem Lachen. Mehr Abstand zum Boden bringt weniger Peronospora-Druck, geringere Frostgefahr und – nebenbei – eine Traubenzone, die selbst für die Schafe unerreichbar bleibt. Der Humor der beiden ist trocken, die Logik dahinter bestechend.

Im Kern aber geht es um etwas anderes: um Leichtigkeit. Nicht als Lifestyle, sondern als Prinzip. Kaum ein deutscher Spitzenbetrieb schafft es, Spätburgunder mit durchschnittlich elf Prozent Alkohol so klar, so strukturiert und so ausbalanciert ins Glas zu bringen. Diese Weine wirken nicht reduziert, sondern entschlackt. Sie tragen nichts Überflüssiges, sie strahlen eine innere Ruhe aus, die sofort Vertrauen schafft. Schon der Handwerk Spätburgunder 2023 zeigt das: eine feine Reduktion, ein Hauch Flint, kaum Frucht in der Nase, dafür im Mund saftige Kirsche, Morelle, zarte Gerbstoffe und eine Intensität, die einen überrascht, wenn man den Alkoholgehalt liest. Der Ortswein aus Dernau steigert das sogar, mit einer delikaten Süsskirsche, einer Komplexität, die man in dieser Gewichtsklasse nicht erwartet, und einer Intensität, die keinerlei Lautstärke braucht. Der Mayschoßer wiederum zeigt den reinen Schiefer mit seiner kühlen, kargen Art, kantig, fordernd, fast streng, ein Wein, der mehr Gesprächspartner als Begleiter ist.
«Die höheren Stämme im Goblet-Schnitt reduzieren den Peronospora-Druck und die Gefahr von Frostschäden.»
Dass dieses Paar zu den Vorreitern einer neuen Ahr gehört, sieht man auch am geplanten Neubau, der in Mayschoß entsteht: ein nachhaltiges, nahezu energieautarkes Gebäude, das mit Erdtemperatur arbeitet, Solarstrom nutzt und Räume schafft, die eher an einen funktionalen Werkzeugkasten erinnern als an eine Kellerei. Hier ist nichts repräsentativ. Alles folgt dem Prinzip: Was wir nicht brauchen, bauen wir nicht ein. Benni Baltes fährt sogar seinen Elektrokastenwagen zwischen Frühjahr und Herbst ohne einen einzigen Besuch an einer Ladesäule – gespeist allein durch den eigenen Solarstrom. Man könnte das als Detail abtun, aber es passt ins Bild: Die Ahr denkt nicht in Maschinenparkgrössen, sie denkt in Systemen. Was Bertram-Baltes so besonders macht, ist diese stille Konsequenz. Die Unterschiede zwischen Ortsweinen und grossen Gewächsen herauszuarbeiten, gelingt ihnen mit einer Präzision, die in Deutschland unvergleichlich ist. Und doch tragen die Weine etwas Spielerisches, fast Leichtfüssiges, das nur entsteht, wenn man die Komplexität des Weinbaus auf seine einfachsten Fragen zurückführt: Wie bleibt ein Boden lebendig? Wie atmet ein Weinberg? Wie entstehen Weine, die man nicht analysieren muss, um sie zu verstehen? An der Ahr findet man darauf viele Antworten, aber kaum eine so klare wie die von Julia und Benni Baltes.

In der Vergangenheit steckt die Zukunft
Wenn man von Bertram-Baltes weiter ins Tal fährt, kommt irgendwann der Punkt, an dem die Ahr ihren Takt wechselt. Die Landschaft wirkt weniger offen, gepresst zwischen den Felsen, und genau hier hat Lukas Sermann sein Reich – eine unscheinbare Halle, mehr Werkstatt als Weingut, doch voll mit dem, was ihm am meisten bedeutet: alten Reben. Manche Menschen sammeln Briefmarken, andere Oldtimer, Sermann sammelt Parzellen. Möglichst wurzelecht, möglichst alt, möglichst dort, wo der Weinbau eigentlich schon aufgegeben wurde. Es ist kein romantischer Impuls, sondern eine Überzeugung: Alte Stöcke erzählen die Wahrheit eines Ortes direkter und unverfälschter als jede moderne Klonwirtschaft. Und Wahrheit ist der Stoff, aus dem seine Weine gemacht sind.

Sermann gehört zu jener Generation von Winzern, die nicht viel brauchen, um viel auszudrücken. Die Halle ist schmal, ein paar Fässer, ein paar Tanks, wenig Technik, kein Spektakel. Was er macht, ist in der Sache pur: kein Entblättern, keine kosmetischen Eingriffe, die Beeren sollen so kühl wie möglich bleiben. Wenn der Saft stimmt, wenn die Balance zwischen Zucker und Säure sitzt, dann entsteht etwas, das man nicht manipulieren muss. Ein Müller-Thurgau, der plötzlich Noten von Pink Grapefruit entwickelt; ein Portugieser aus einer 60 Jahre alten Parzelle, der zeigt, wie viel Spannung in einer Sorte steckt, die anderswo als Laune angebaut wird.
«Ich will, dass man die raue Natur, das einmalige Terroir der Ahr, in jedem Wein spürt. Und das geht am besten mit alten Rebstöcken.»
Viele dieser Weine landen nie im Sortiment. Aber sie erzählen, worauf es Sermann ankommt: auf die Möglichkeit, nicht auf das Ergebnis. Sein eigentliches Kapital aber liegt im Berg. In Parzellen, die so steil sind, dass man sich fragt, wie dort jemals Weinbau möglich war. 120 Jahre alte Reben, Einzelstock, Natursteinmauern wie aus einem anderen Jahrhundert. Sermann hat hier Begrünung eingeführt, ein Schritt, der die Stöcke zwingt, sich selbst zu regulieren. Konkurrenz sorgt für Konzentration, nichts muss abgeschnitten werden, nichts wird nachjustiert. 15 Hektoliter pro Hektar, sagt er, seien einfach das, was die Rebstöcke geben und genau diese Menge füllt er. Es ist ein radikal unmodernes Denken, das paradoxerweise extrem zeitgemäss wirkt. Herkunft, nicht Technik. Geduld, nicht Konstruktion. Und dann ist da noch das Altenahrer Eck, eine dieser Lagen, die man nur schwer vergisst. Drei Betriebe bewirtschaften sie gemeinsam: Sermann, der Deutzerhof und die Genossenschaft. Ein Monolith aus Stein und Geschichte, dreieinhalb Hektar, begrenzt von Felsvorsprüngen, direkt an der Ahr, kühl und doch gerade so warm, dass Spätburgunder und sogar Riesling reifen. Riesling an der Ahr – auch das ist eine Besonderheit und einer der Gründe, warum Sermann heraussticht.

Er gehört zu den wenigen Winzern, die die Sorte hier nicht als Kuriosität, sondern als Chance begreifen. Und seine Rieslinge können tatsächlich etwas, das man hier kaum erwartet: Sie schmecken nicht nach Riesling. Zumindest nicht nach dem, was man landläufig darunter versteht. Sie sind kräuterwürziger, steiniger, weniger varietal. Es ist, als würde der Schiefer sich direkt in die Aromatik einschreiben. Dass Sermann zugleich Vorstand des Ahrwein e. V. ist, passt ins Bild. Er denkt nicht nur für seinen Betrieb, sondern für das Tal. Für die Frage: Wie soll die Ahr klingen und welches Bild soll sie nach aussen tragen? Seine Antwort ist leise. Keine grossen Parolen, keine PR-Sätze. Sondern ein Weinbau, der sich nicht erklärt, sondern beweist. Man muss seine Weine nicht mögen, um zu verstehen, dass sie notwendig sind. Denn sie zeigen eine Ahr, die nicht auf Kalk wartet, um ernst genommen zu werden. Eine Ahr, die in alten Stöcken die Zukunft sucht. Und in einem jungen Winzer findet sie die Ruhe, sie freizulegen.

Eleganz als Markenkern
Der Deutzerhof wirkt auf den ersten Blick wie ein Gegenentwurf zu den jungen Wilden des Tals. Ein traditionsreicher VDP-Betrieb, über Jahrzehnte fester Bestandteil der ersten Liga, mit einer Geschichte, die tief im Ahrtal verankert ist. Und doch ist gerade hier in den letzten Jahren etwas passiert, das man fast übersehen könnte, wenn man die Weine nur aus der Distanz kennt. Früher trugen sie den Schiefer wie eine Monstranz vor sich her, stolz, unmissverständlich, manchmal auch ein wenig laut. Diese Herkunft war ein Statement, sie definierte den Charakter und dominierte ihn zugleich. Heute ist das anders. Der Schiefer ist immer noch da, natürlich, als Rückgrat, als Grundspannung. Aber er wirkt eingebunden, feiner verwoben, weniger als Signalgeber und mehr als Substanz. Als hätte der Deutzerhof beschlossen, die Herkunft nicht mehr zu zeigen, sondern sprechen zu lassen. Es ist eine Entwicklung, die man im Glas sofort spürt. Der typische, oft kantige Schieferduft tritt einen Schritt zurück, macht Platz für eine Eleganz, die in früheren Jahren manchmal nur angedeutet war. Die Weine haben innere Ruhe gewonnen, eine Art Selbstverständlichkeit, die nichts beschönigt, aber vieles sortiert. Man könnte es als Reifeprozess beschreiben, doch das greift zu kurz. Es ist eher ein Perspektivwechsel: Weg vom demonstrativen Herkunftsbeweis, hin zu einer feineren, leiseren, aber umso präziseren Interpretation dessen, was dieses Tal kann.
«Nicht jeder Wein muss dauerhaft ins Programm kommen. Manchmal ist die reine Freude am Wein schon Grund genug, etwas zu tun.»
Vielleicht hat die Flut auch hier einen Teil dazu beigetragen – nicht als stilistischer Wendepunkt, sondern als Erkenntnis, dass Authentizität nicht zwingend Lautstärke braucht. Gleichzeitig bleibt der Deutzerhof fest auf dem Boden der Realitäten. «Die Produktionskosten an der Ahr sind aufgrund der Terrassenlagen um einiges höher als in anderen Anbaugebieten. Der Einstiegswein liegt bei 13 Euro – das ist in anderen Gebieten die Mittelklasse. Um da nicht unterzugehen, müssen wir qualitativ Schritt halten», erklärt Betriebsleiter Hans-Jörg Lüchau. Ein nüchterner Satz, der viel erklärt. Der Deutzerhof kann sich keine halben Schritte erlauben, keine Experimente, die am Markt vorbeigehen. Und genau darin liegt die Kunst: die Balance zu finden zwischen einer jahrzehntelang gewachsenen Identität und einem Stil, der die Ahr nicht schwerer macht als sie ohnehin schon ist. Vielleicht ist es kein Zufall, dass dieser Betrieb gerade jetzt zu einer neuen Form gefunden hat. In einem Tal, das sich neu sortiert, wirkt der Deutzerhof wie ein Fixpunkt – aber einer, der sich bewegen kann. Man schmeckt es in den aktuellen Spätburgundern: die vertraute Schieferwürze, klar und kühl, aber nicht mehr kantig; die Gerbstoffe seidig, straffer gefasst; die Säure als feine Linie, nicht als Schneide. Es sind Weine, die nicht mehr beweisen wollen, dass sie von der Ahr kommen. Sie tun es einfach. Und genau das macht sie heute stärker als früher. Der Deutzerhof steht damit für eine Ahr, die sich ihrer Herkunft sicher ist, ohne sie auszustellen. Für ein Tal, das gelernt hat, dass Grösse nicht im Gewicht liegt, sondern in der Art, wie ein Wein atmet. Und für einen Stil, der aus einem berühmten Betrieb wieder einen spannenden gemacht hat. Man kann Herkunft mit dem Holzhammer zeigen. Oder man kann sie einbinden, bis sie selbstverständlich wird. Der Deutzerhof hat sich für den zweiten Weg entschieden – und selten stand ihm dieser Weg so gut. Nicht umsonst wurde der Deutzerhof 2025 beim VINUM Deutscher Rotweinpreis als «Roter Riese» ausgezeichnet.
Veränderung, die schmeckbar ist
Beim Deutzerhof hat sich der Stil verfeinert, und kaum anders ist es bei Kreuzberg. Lange galt der Betrieb als Inbegriff des klassischen Ahrstils: schieferbetont, kantig, herb, mit einer Würze, die man buchstäblich aus dem Glas springen sah. Herkunft als Ausrufezeichen. Doch in den letzten ein, zwei Jahrgängen hat sich etwas verschoben. Die Weine sind freundlicher geworden, offener, ohne an Tiefe verloren zu haben. Der Schiefer steht nicht mehr wie ein Monument im Raum, sondern trägt die Struktur, verleiht Spannung, ohne zu dominieren. Es ist ein leiserer, dabei präziserer Stil – und er steht dem Haus erstaunlich gut. Dass dieser Wandel kommt, überrascht nicht, wenn man mit Kellermeister Benno Wagner spricht, einem gebürtigen Münchner, der mit einer Mischung aus Gelassenheit und Akribie arbeitet. Gemeinsam mit dem Inhaber Ludwig Kreuzberg hat er den Kurs sachte angepasst. Weniger Extraktion, feinere Tanninpolitik, weniger Betonung der kantigen Aromatik, dafür mehr Transparenz und Durchlässigkeit.
«Ich habe noch nie einen Wein entsäuert oder aufgesäuert. Das muss man im Weinberg hinbekommen. »
Die neuen Spätburgunder wirken, als könne man durch sie hindurchsehen, ohne dass sie an Komplexität einbüssen. Und genau darin liegt die Qualität: Es sind Weine, die sich öffnen, statt den Trinker zu prüfen. Wie stark sich der Stil verändert hat, erkennt man erst im Vergleich mit älteren Jahrgängen. Eine kurze Vertikale im Keller wirkt wie ein Blick in ein anderes Kapitel. Der 2016er zeigt Reife und Oxidation, der 2015er präsentiert den klassischen Schiefer ohne Frucht dafür mit Kräutern und Tabak, der 2014er überrascht mit feiner Kirschfrucht und straffem Tannin und der 2013er bringt dunkle Würze und herbe Noten – alles solide Beispiele einer früheren Ahr, die mehr über Härte als über Feinheit definierte. Doch stellt man daneben einen aktuellen 2022er oder 2023er, kippt das Bild sofort. Plötzlich stehen da Weine, die nicht mehr stolz auf ihre Kargheit sind, sondern auf ihre Balance. Die Herkunft ist immer noch eindeutig, aber sie wird nicht mehr mit dem Holzhammer ausgeschenkt.

Vielleicht hängt auch das mit der besonderen Struktur des Tals zusammen. Mit 530 Hektar ist die Ahr eine der kleinsten Weinregionen Deutschlands, und man kennt sich unter den Kollegen. Seit der Flut arbeiten die Betriebe aber noch enger zusammen als zuvor. Man probiert miteinander, nicht gegeneinander, man tauscht Ideen aus, nicht Befindlichkeiten. Die jungen Kollegen setzen neue Akzente, die Älteren lassen sich inspirieren, ohne sich zu verbiegen. Es ist ein bemerkenswerter Moment: Eine Region entwickelt ihren Stil nicht über Marktmechanismen, sondern über Dialog. Und Kreuzberg ist eines der Häuser, bei denen dieser Dialog unmittelbar schmeckbar wird. So entsteht ein Weinbild, das eine Brücke schlägt zwischen Tradition und zeitgemässer Eleganz, zwischen Herkunft und Leichtigkeit. Schiefer ist hier nicht verschwunden, er hat nur eine andere Rolle bekommen. Er trägt statt zu führen. Er akzentuiert statt zu bestimmen. Und vielleicht zeigt sich gerade in diesen Weinen, was das Tal insgesamt prägt: die Fähigkeit, sich zu verändern, ohne sich zu verlieren.

Ein persönliches Resümee…
Wenn man heute durch das Tal fährt, zwischen Baustellen, neu gesetzten Mauern und den ersten fertig restaurierten Häusern, versteht man vielleicht zum ersten Mal, wie weit die Ahr gekommen ist. Und dass der Satz, der als Überschrift über dieser Geschichte steht, mehr ist als ein ironischer Seitenhieb. «Auf Kalk kann es ja jeder» – dieser Satz enthält eine halbe Wahrheit und eine ganze Erkenntnis. Denn natürlich gedeiht Spätburgunder – und auch Pinot Noir – auf Kalk in einer Art, die elegant, fein und geradezu selbstverständlich wirkt. Kalk trägt, er hellt auf, er schenkt Frische, er sortiert die Textur. Wer auf Kalk grosse Pinots macht, folgt einer Logik, die man überall auf der Welt kennt. Doch die Ahr folgt keiner Logik, sie folgt ihrer Topografie. Schiefer und Grauwacke machen es den Reben nicht leicht. Sie speichern Wärme, sie liefern Mineralität, aber sie bringen Härte, Kante, Spannung. Auf diesem Fundament einen eleganten Pinot zu erzeugen, ist keine Verlängerung burgundischer Tradition, sondern eine Kunstform. Und vielleicht erklärt sich erst aus diesem Gegensatz, warum die Region heute stilistisch dort steht, wo sie steht. Früher versuchte man, Rotwein zu machen: dicht, farbintensiv, alkoholreich, mit einem Selbstbewusstsein, das manchmal mehr behauptete, als es hielt. Die Weine hatten Kraft, aber oft wenig Luft. Sie erzählten vom Ehrgeiz eines Tals, das zeigen wollte, was es kann. Heute erzählt die Ahr eine andere Geschichte. Nicht mehr vom Rotwein, sondern vom Spätburgunder. Von Leichtigkeit, die nicht dünn wirkt, von Eleganz, die sich aus Tiefe speist, von Kraft, die nicht drückt, sondern trägt. Die jungen Betriebe zeigen, wie transparent ein Ahr-Pinot sein kann, ohne seinen Kern zu verlieren. Die etablierten Häuser haben Feinheit gelernt, ohne sich zu verleugnen. Und gemeinsam hat das Tal eine neue Ästhetik gefunden: weniger laut, weniger auftrumpfend, dafür fokussierter, präziser, eigenständiger. Eine Ästhetik, die nicht versucht, das Burgund zu imitieren, sondern die Ahr zu erklären. Vielleicht ist das der eigentliche Triumph dieses schmalen Flusstals, das noch immer mit den Folgen seiner grössten Katastrophe ringt: dass es sich gerade jetzt, zwischen Rohbau und Wiederaufbau, neu definiert hat. Es gibt wenige Orte, an denen Stilfragen so eng mit Landschaft und Lebenswirklichkeit verknüpft sind wie hier. Und wenige Regionen, die aus dem Zwang zur Einfachheit so viel Qualität ziehen. Wer die neuen Jahrgänge probiert, spürt sofort, wie klar diese Weine geworden sind. Wie selbstverständlich sie Herkunft, Eleganz und Kraft verbinden. Und wie wenig sie brauchen, um zu wirken. Ganz am Ende steht man dann wieder an einem jener Terrassenwege, zwischen Mauern, auf denen die Eidechsen dösen, und Stöcken, die seit hundert Jahren in den Himmel wachsen. Man schaut ins Tal, hört die Ahr, und plötzlich ergibt der Satz wieder Sinn – diesmal in voller Länge. Auf Kalk kann es ja jeder. Aber hier, auf Schiefer und Grauwacke, in diesem Tal aus Stein und Mühe, gelingt etwas, das anders ist. Nicht besser, nicht lauter, nicht prestigeträchtiger. Sondern eigen. Und darin liegt die eigentliche Kunst. Oder als ganzer Satz gesagt: Auf Kalk kann es ja jeder, auf Schiefer ist es Kunst.